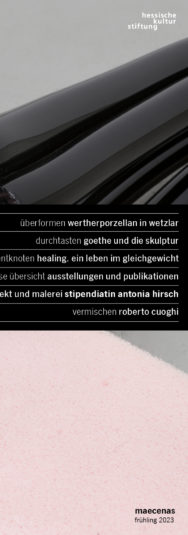stipendiatin antonia hirsch
In ihrer Praxis kombiniert Antonia Hirsch Rohmaterialien technischer Alltagsgegenstände mit abstrahierten Formen, insbesondere aus der digitalen Bild- und Kommunikationstechnik. Ihre Arbeiten reichen von kleinformatigen Objekten bis zu raumgreifenden Installationen und bedienen sich sowohl skulpturaler als auch medialer Formate. Die Werkreihen der in Frankfurt am Main geborenen, heute in Berlin lebenden Künstlerin, die am Central Saint Martins College for Art and Design in London studierte und von 1994 bis 2010 in Vancouver, Kanada, wohnte, werden häufig von Buchprojekten begleitet. Letztere artikulieren – parallel zu ihrer Arbeit im Atelier – ihr Interesse an wissenschaftlich-philosophischen Problemstellungen; so zum Beispiel die Frage, wie sich quantitative, räumliche und syntaktische Systeme oder Darstellungsstrukturen mit der sinnlichen Wahrnehmung verschränken, um letztlich ein Verständnis unserer Welt zu ermöglichen.
Im Jahr 2022, als Japan nach den Jahren der Pandemie wieder seine Grenzen öffnete, nutzte sie das Reisestipendium der Hessischen Kulturstiftung für den ersten von insgesamt zwei geplanten Aufenthalten in Japan. Zwischen diesen beiden Reisen spricht sie mit Gregor Jansen, Kunsthistoriker und Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, über ihre Erfahrungen auf ihrem ersten Field Trip.
Gregor Jansen Roland Barthes verfasste nach einer Reise nach Japan ein Buch mit dem Titel Das Reich der Zeichen. Das war 1970. Sein semiotisches Abenteuer im Fernen Osten ist heute für einige immer noch vorbereitende Reiselektüre. Er selbst hatte ja davon gesprochen, das reale Japan sei ihm ,gleichgültig‘ und lediglich ein Lieferant von Material für sein sprachtheoretisches ,Spiel‘. Wie erging es dir heute, umgeben von Zeichen? Was war dein Grund, nach Japan reisen zu wollen?
Antonia Hirsch Ich glaube, jetzt, nachdem ich zum ersten Mal dort war, wird mir klar, dass ich so etwas wie eine Ahnungslosigkeit gesucht habe, eine Situation, in der ich mich weit weniger als gewöhnlich auf sprachlich vermittelbares Wissen verlassen konnte.
Das Konzept für meine Recherchereise war ja, dem im Japan der Siebzigerjahre artikulierten Kansei Engineering nachzuspüren. Dabei handelt es sich – besonders bei Alltagsgegenständen – um eine Designstrategie, die auf Affekte abzielt, also beispielsweise bei der Gestaltung eines Autos, dessen Kühler zu lächeln scheint. Diese Designstrategie hat sich mittlerweile weltweit durchgesetzt und ist typisch für die aktuelle Form des Kapitalismus geworden.
Das Reisestipendium der Hessischen Kulturstiftung ist komplett offen angelegt. Man organisiert alles selbst, es gibt niemanden, der einen am Zielort empfängt und an die Hand nimmt. Wie viele Europäer heute reise ich und lerne neue Orte im Allgemeinen mit einer gewissen routinierten Gelassenheit kennen. Aber Japan war ganz anders für mich: Da ich die Sprache nicht beherrsche, war ich erstmal komplett darauf zurückgeworfen, meine Umgebung durch Bilder, Formen, Gesten und so weiter zu verstehen.
Gregor Jansen Deine Erwartungen und Erfahrungen, deine Wahrnehmung der Exklusion ist ganz typisch. In Japan wirst du neu geboren und lernst, die Welt zu erfinden, deren Sinn zu erforschen – was die Fotos, die du als eine Art visuelles Tagebuch aufgenommen und mir gezeigt hast, ja auch wunderbar widerspiegeln.
Antonia Hirsch Du kennst das ja aus deinen eigenen Reisen nach Japan! Diese Erfahrung ist deshalb bemerkenswert, weil auf der Oberfläche alles sehr ähnlich erscheint, wie man es aus Europa oder Nordamerika kennt. Zudem ist alles so sauber und ordentlich, dass sich klar vermittelt, dass es Ordnungen und Systeme gibt – und hier kommen wir auf den von dir erwähnten Roland Barthes zurück: Man erkennt sowohl praktische Systeme, zum Beispiel administrative, als auch semiotische. Und wenn man sie erkennt, erwartet man auch, sie durchdringen zu können. Aber mir erschien es oft, als würde ich alles wie durch eine Glasscheibe mitbekommen: Ich konnte das Erlebte anscheinend nie ganz für mich erschließen.
Bei meinen Reisen geht es daher letztlich nicht darum, mir so etwas wie Fakten anzueignen, sondern eher eine Haltung oder einen Erfahrungsmodus einzunehmen – also auf einer sinnlichen, affektiven Ebene zu operieren.
Gregor Jansen Wenn du über den affektiven Aspekt des Kansei Engineering sprichst, lässt mich das an Wabi-Sabi denken. Beide Konzepte verdeutlichen einem schnell die Dimension einer ähnlich gelagerten und doch vollkommen anderen Kultur.
Wir wundern uns über asiatische Besucher, die hier alles fotografisch erfassen, ertappen uns dort aber auch als staunende Bilder-Jäger inmitten von einer scheinbar perfekten Dingwelt und Natur, die wesenhaft und sauber, aber auch voller Poesie, tiefer Melancholie und von einem spirituellen Sehnen bestimmt sind. Das zeigen deine Fotografien auch. Kannst du dem zustimmen oder geht es für dich um etwas anderes?
Antonia Hirsch Die Philosophie des Wabi-Sabi zeigt sich ganz deutlich in Mingei, der japanischen Volkskunst-Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Dass du Kansei Engineering und Wabi-Sabi in einen Zusammenhang bringst, ist interessant. Denn beide Phänomene zielen, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, auf eine affektive Beziehung mit Objekten ab. Im japanischen Kunsthandwerk drückt sich das oft darin aus, dass man die menschliche Hand, das Imperfekte, erkennt und auch eine materielle Vergänglichkeit. Industriell hergestellte, nach Kansei-Engineering-Strategien entwickelte Produkte dagegen sind aalglatt, und so etwas wie Verfall gibt es für sie offiziell nicht.
Gregor Jansen Laut Leonard Koren drückte ,Wabi‘ ursprünglich ein Gefühl der Entmutigung und Freudlosigkeit aus, sich elend, einsam und verloren zu fühlen. Heute ist ,Wabi‘ vielleicht mit unserer Romantik vergleichbar, ähnlich jener stillen Freude an der Schwermut der Einsamkeit. In der Verbindung mit ,Sabi‘, was solche Qualitäten wie Kühle und Welkheit, aber auch Patina und Reife ausdrückte, entstand die kaum übersetzbare Begriffseinheit, die das vielleicht charakteristischste Merkmal traditioneller japanischer Ästhetik beschreibt.
Antonia Hirsch Richtig. Industriell hergestellte Objekte erhalten dagegen ihre affektive Qualität durch eine begehrenswert erscheinende Perfektion und oft zusätzlich durch den Aspekt des Niedlichen, den man auch von Kawaii kennt. Was ich faszinierend finde, ist, wie alltägliche Produkte, sagen wir eine Haarbürste, neben ihrer Aura als Ware so etwas wie eine gesellschaftliche Verfasstheit widerspiegeln können. Kawaii, das auf Kindlichkeit und Unschuld verweist, ist ja ein Nachkriegsphänomen in Japan. Ich würde wagen zu behaupten, dass gesellschaftlich gesehen die Anziehungskraft von Kawaii sich zumindest teilweise aus der Erfahrung von Gewalt im Zweiten Weltkrieg speiste. Japan hat da interessante Parallelen zu Deutschland insofern, als es zum einen schreckliche Grausamkeiten verübte, zum anderen solche auch selbst erfahren musste. Dass daraus eine unglaubliche Sehnsucht nach Unschuld entstand, ist nicht unbedingt erbaulich, aber doch irgendwie nachvollziehbar. Ich denke, in Deutschland fand etwas Ähnliches statt, aber vor dem Zweiten Weltkrieg. Im Mai 1945 hat zum Beispiel Thomas Mann bei einem Vortrag vor der Library of Congress seine Idee der ,machtgeschützten Innerlichkeit‘ ausgeführt. Das war ein Versuch, die deutsche Innerlichkeit – wie man sie etwa aus der Romantik kennt, die du ja auch gerade als Parallele zum Begriff des Wabi genannt hast – im politischen und geschichtlichen Kontext kritisch zu betrachten, nämlich als Wegbereiter des Faschismus: Das kommt mir erschreckend aktuell vor, wenn man an Filterblasen und anderes denkt, und die Pandemie hat solche Tendenzen noch verstärkt. Ich selbst habe während dieser Zeit den direkten menschlichen Kontakt oft unwillkürlich als potenziell gefährlich wahrgenommen, und anscheinend ging es vielen so. Der Austausch, der aber ungehemmt stattfand, war der von Waren, von Dingen. Bei reduzierten Sozialkontakten sind es möglicherweise Objekte aller Art, auch oder besonders Konsumartikel, durch die wir uns emotional verbinden und erden. Das ist es eigentlich, was ich in meiner Arbeit ergründe: Wie Objekte – durch ihre Form und Beschaffenheit – die Befriedigung emotionaler und kreatürlicher Bedürfnisse versprechen und dadurch gesellschaftliche Zustände und Dynamiken beleuchten.
Gregor Jansen Das erkennt man in deiner Kunst, aber auch in deinen Fotografien aus Japan. Da geht es vor allem um die Dingwelt. Unter deinen Fotos gibt es zum Beispiel eine vielteilige Typologie von japanischen Verkehrsleitkegeln. Und dann ist da auch diese Glasscheibe, die du anfangs erwähnt hast. Im übertragenen Sinne könnte man an die Linse, dein Objektiv, denken, die einerseits das Sehen, den Kontakt, ermöglicht, andererseits aber auch trennend ist. Mich lässt das an die Geisterwelt des Shintoismus denken, bei dem es auf der Erde keine seelenlosen Dinge gibt. Acht Millionen Gottheiten, so heißt es, besiedeln die Glaubenswelt des Shintō: die Kami. Wirklich alles lebt, auch im hektischen Moloch der Großstadt, und uns fehlt nur die Brille (Linse), diese animistische Seite der Welt zu sehen, wir rutschen an den Oberflächen ab. Wir trennen sehr stark Geist und Materie, aber in deiner Kunst habe ich den Eindruck, dass du die westlichen Kami erforschst, wie zum Beispiel bei Black Echo oder auch Bob. Wir sehen durch dich die Dinge als Teil eines erkenntnistheoretischen Systems, aber nicht als Erklärungsmodell. Stimmst du dem zu?
Antonia Hirsch Ich finde es sehr spannend, dass du die Sprache auf Geister bringst, wobei ich wirklich sehr wenig über sie weiß, ob es sich nun um Shintō-Geister handelt oder andere. Ich schlage mich aber seit längerer Zeit mit drei Objektkategorien herum – dem Talisman, dem Kunstobjekt und dem Konsumartikel. Diese drei haben etwas gemeinsam, nämlich die ihnen zugesprochene Aura, und doch sind sie total verschieden. Dabei könnte man, anstatt von einer Aura als einer Kraft, die über das Materielle hinausgeht, zu sprechen, auch sagen: Diesem Objekt wohnt ein Geist inne, es ist irgendwie beseelt. Obwohl mir das aus westlicher Perspektive ein bisschen zu ,new-agey‘ ist. Aber du hast recht, besonders Black Echo nimmt sogar mittelbar auf eine Geisterwelt Bezug. Die Arbeit ist ja nicht nur von Bildschirmen unserer zeitgenössischen mobilen Geräte inspiriert, sondern beruft sich auch auf solche historischen Instrumente wie ,okkulte‘ schwarze Spiegel, durch die in der Spiritismus-Bewegung im Europa des 19. Jahrhunderts Kontakt zu Geistern aufgenommen werden sollte. Ähnlich verhielt es sich mit präkolumbianischen, mesoamerikanischen schwarzen Spiegeln, die aus Obsidian gefertigt wurden, sogenannte rauchende Spiegel, symbolische Objekte, die es dem Nutzer ermöglichen sollten, zu sehen und gesehen zu werden.
Wenn ich deine Frage also umformulieren darf: Ob man durch meine Kunst Erklärungsmodelle erkennen kann, dann würde ich sagen: Das hoffe ich. Es ist eigentlich ein Paradox. Denn Erklärungsmodelle sind ja so etwas wie eine rationale Reflexion dessen, was mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. So wie ich mich mit den Dingen auseinandersetze, versuche ich, die Erklärungsmodelle selbst – und ihre etwa ideologischen Verzerrungen – anhand von Objekten zu manifestieren, aber dabei ist es mein Ziel, die Dinge wieder sinnlich erfahrbar zu machen.
Gregor Jansen Dem stimme ich zu, denn deine Kunst löst ästhetisch alles ein, was gefordert werden darf; sinnlich lässt sie auf den von dir erklärten Ebenen erstaunliche Wahrnehmungsmodi zu, ist intellektuell auf hohem Niveau und bezieht zugleich das Geistige, Metaphysische und Irrationale mit ein. Im Gegensatz dazu begeistern sich Japaner:innen sehr betont für eine Dingwelt, die weder Schwere noch Substanz zu kennen scheint und in der alles, inklusive der Speisen, dazu geschaffen ist, Gesten und zeremonielle Handlungen zu ermöglichen. „Man darf keine empfindsame Seele nach Japan mitbringen“, formulierte 1976 Nicolas Bouvier. Und der Reisebericht von Roland Barthes schließt mit: „Es gibt nichts zu greifen.“ Beide Aussagen sind als die Quintessenz glücklicher Begegnungen anzusehen.
Ich wünsche dir trotzdem Empfindsamkeit für deine zweite Reise und viele Begegnungen mit Menschen aller Couleur, Geister hin oder her. Lass uns nach deiner erneuerten Erfahrung unbedingt daran teilhaben! Vielen Dank, Antonia, und eine gute Zeit im unergründbaren Reich der Zeichen.
Antonia Hirsch Ich danke dir!